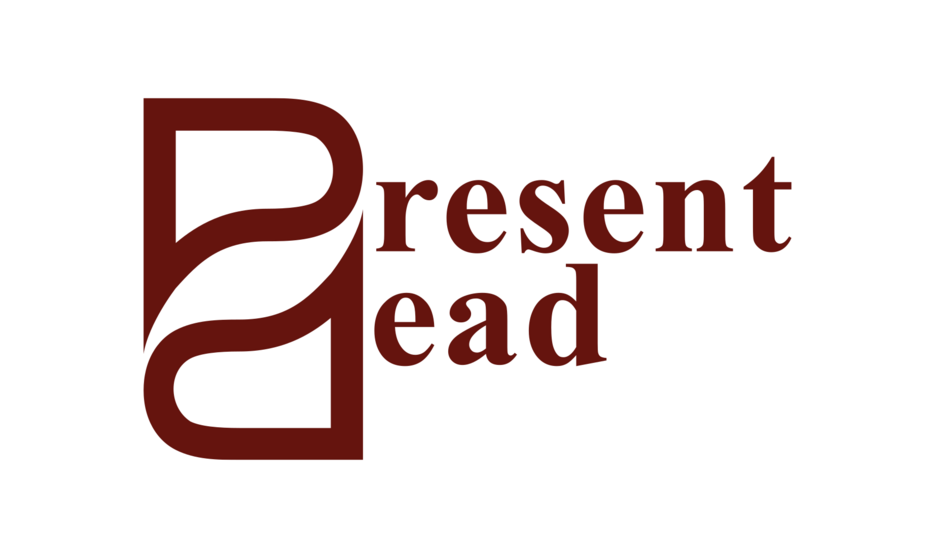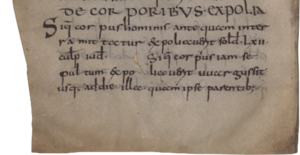The Present Dead
Interaktionen zwischen Lebenden und Toten im frühmittelalterlichen Mittel- und Osteuropa vom 5. bis 8. Jahrhundert n. Chr.
Gefördert von der Europäischen Union (ERC, PresentDead, 101089324)
Das Projekt untersucht die praktischen, konzeptionellen und emotionalen Dimensionen von Interaktionen mit menschlichen Überresten und Artefakten in Gräbern des frühmittelalterlichen Mittel- und Osteuropas (5. bis 8. Jahrhundert n. Chr.). Auf Grundlage archäologischer und schriftlicher Quellen wird die Beziehung zwischen den Lebenden und den Toten durch einen innovativen Ansatz untersucht, der modernste wissenschaftliche Methoden, technische Lösungen und neue theoretische Ansätze kombiniert. Die Arbeitshypothese des Projekts ist, dass sich Praktiken und Sichtweisen mit den rituellen Phasen des Bestattungszyklus verändern.
In frühmittelalterlichen Gräberfeldern wurden viele Gräber kurz nach der Bestattung wiedergeöffnet und dadurch „gestört“. Während diese Gräber andernorts als minderwertige Quelle angesehen wurden, geht dieses Projekt davon aus, dass diese Eingriffe wichtige Hinweise auf frühmittelalterliche Praktiken im Umgang mit den Toten sind.
Die Hauptziele des Projekts sind
1. Archäologie: Untersuchung des Spektrums von Praktiken im archäologischen Befund
Die Untersuchungen der archäologischen Hinterlassenschaften bewegen sich von hoch-auflösenden Ansätzen, in denen viele Details erhoben werden (mikro-archäologische Ausgrabungen und Rekonstruktionen), bis hin zu niedrig-auflösenden Herangehensweisen (Integration bestehender Datensätze und rechnerische Bearbeitung von bereits publizierten und online zugänglichen Bilddaten). Die hochauflösenden Ansätze informieren alle anderen Zugänge.
Zentral für die Auswertung der archäologischen Befunde ist eine Methode der Bioarchäologie, die sogenannte "Archäothanatologie", welche in den letzten Jahrzehnten in Frankreich entwickelt wurde. Grundlage ist eine detaillierte Erfassung der Positionierung der einzelnen menschlichen Knochenelemente und anderer Gegenstände mit dem Ziel das ursprüngliche Aussehen eines Grabes, sowie die Entstehung des archäologischen Befundes zu rekonstruieren.
Hoch-auflösende Analyse: Mikroarchäologische Ausgrabungen, Rekonstruktionen
Die mikroarchäologischen Ausgrabungen umfassen unter anderem eine 3D-Einzelfundaufnahme, einschließlich aller Knochen in "gestörter" Lage mit einem Tachymeter, strategische Bodenprobenentnahmen (gestörte und ungestörte Proben) und Nasssieben der Sedimente.
Die detaillierten Ausgrabungsdaten bilden die Grundlage für die 3D Visualisierung des Entstehungsprozesses der Gräber. Mit den digitalen Modellen können unterschiedliche Interpretationen visualisiert und getestet werden.
Da es sich um eine ressourcenintensive Methodik handelt, wird nur eine kleine Anzahl ausgewählter Gräber analysiert.
Die Arbeit in Archiven und Sammlungen: Untersuchungsregionen in Österreich, Ungarn, Rumänien und Slowenien
Anhand von früheren Ausgrabungen von Gräberfeldern in vier zentral- und osteuropäischen Untersuchungsregionen werden wir Befunde von Gräbern, in die nachträglich eingegriffen wurde, und solche, die intakt gelassen wurden, genau untersuchen und miteinander vergleichen. Die Grundlage bilden die von uns entwickelten Untersuchungsprotokolle für menschliche Skelette, die Artefakte und natürlich die Ausgrabungsdokumentation.
1. Donautal (Ostösterreich)
2. Pannonische Tiefebene (Ungarn)
3. Transsilvanische Hochebene und Nordpannonische Tiefebene (Rumänien)
4. Südöstliche Alpenregion (Österreich & Slowenien)
Niedrig auflösende Analyse: Datenintegration und (halb-)automatische Klassifizierung von Bilddaten
Der dritte Teil der archäologischen Analyse umfasst ausschließlich rechnerische Prozesse. Dabei wird unsere Projektdatenbank mit existierenden Datensätzen ergänzt und in einem weiteren Schritt wird versucht, die zeichnerische Dokumentation der Grabbefunde automatisch oder halbautomatisch bezüglich Art der Graböffnung zu kategorisieren.
2. Analyse von Handlungen und Perspektiven in verschiedenen Textgattungen
Die Störung von Gräbern und/oder Leichen erscheint in verschiedenen Gattungen frühmittelalterlicher Texte. Die Identifizierung relevanter Schriften beginnt mit zwei breiten Kategorien, nämlich historiographischen und regulativen Texten. Danach wird die Suche auf andere schriftliche Quellen mittels Stichwörtern und Indexbegriffen in Zusammenhang mit Leichen, Bestattungen und Gräbern in kritischen Editionen und digitalen Korpora mittelalterlicher Texte ausgeweitet.
3. Synthese von materiellen und schriftlichen Perspektiven geleitet von einer innovativen technischen Lösung für die semantische Integration von Daten
Durch die interdisziplinäre Arbeit des Projektteams ist die Synthese und Integration der unterschiedlichen Perspektiven auf Eingriffe in Gräber ein fortlaufender Prozess während der gesamten Projektdauer. Themen und Fragen, die sich aus dem materiellen Befund ergeben, werden die textliche Analyse beeinflussen – und umgekehrt. Weiters wird die Komplexität der Beziehungen zwischen den Informationen aus den verschiedenen Arten von Quellen durch innovative digitale Lösungen wie etwa durch die semantische Integration der Projekt-Daten dargestellt.